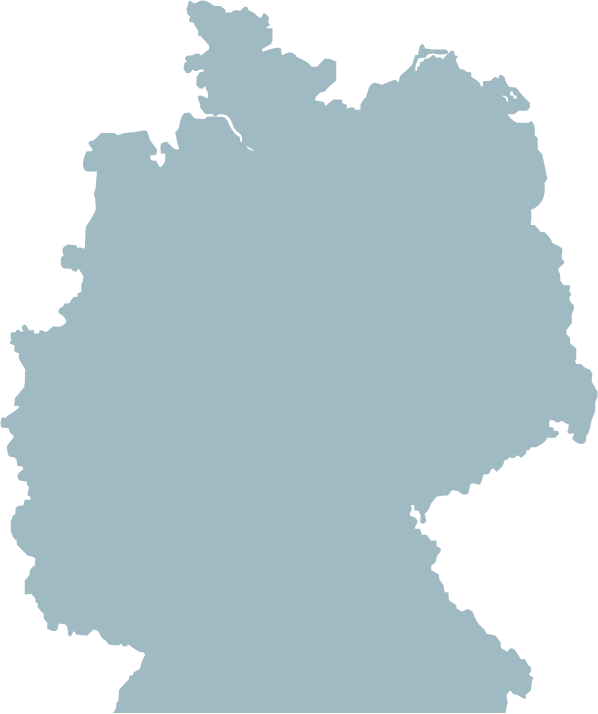Es wird gesagt, Maria Montessori habe sich in den 1920er Jahren dem italienischen Diktator Benito Mussolini angedient, sich später aber mit den Faschisten überworfen. Wie ist das aus heutiger Sicht einzuschätzen?
Boysen: Um diese Frage zu beantworten, muss man etwas weiter ausholen. In Italien war nach dem Ersten Weltkrieg das allgemeine Bildungsniveau sehr niedrig und der Zugang zu Bildung stark eingeschränkt. Eine liberale Regierung versuchte, pädagogische Reformen durchzusetzen, aber diese Bemühungen kamen durch Mussolini, der 1922 an die Macht kam, zum Stehen. Er hat dann nach einer Staatspädagogik gesucht, die mit den faschistischen Vorstellungen des gehorsamen Untertanen kompatibel war, nationalistisch, dienend, sich unterordnend, und hoffte bei Maria Montessori, die weltweit anerkannt war, fündig zu werden.
Montessori hingegen hatte den Ehrgeiz, die Pädagogik in ihrem Heimatland zu reformieren, bedingt auch durch ihre Vorgeschichte als Medizinerin und Anthropologin dort – und dem ganzen Elend, was sie dabei erlebt hat. Sie hatte in den zehn Jahren zuvor weltweit Erfolge mit ihrer Pädagogik gefeiert, wurde von Politikern, von der High Society überall auf der Welt hofiert, bloß in Italien bekam sie kaum ein Bein auf die Erde.
Hinzu kam, dass sie es in den wenigsten Fällen in anderen Ländern geschafft hatte, ihre Pädagogik in den staatlichen Systemen zu verankern, was auch daran lag, dass sie bestrebt war, über die Umsetzung der Pädagogik die Kontrolle zu behalten. Und so hat sie sich – an die Männerwelt gewöhnt, gegenüber der sie sich schon seit der Schulzeit durchsetzen musste – an den Mann an der Spitze gewandt, sich dabei fast angebiedert, weil ihr das als beste Chance erschien, etwas zu bewirken und dabei gleichzeitig, weil sie in Italien schon bekannt und anerkannt war, die Kontrolle zu behalten.
Gleichwohl überwarf sie sich dann später mit den Faschisten. Wie ist das dann einzuordnen?
Boysen: Zunächst sollte die Montessori-Pädagogik im faschistischen Italien tatsächlich zur Staatspädagogik werden. Wenn man etwas genauer hinschaut, dann gab es sehr wohl Anläufe, aber auch viel Widerstand in den Ministerien. Es ist offensichtlich, dass das Regime sich auch mit ihr schmücken wollte. Diese Spannungen führten Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre dazu, dass sich Montessori immer wieder bei Mussolini beschwerte, es gehe ja nicht voran.
Im Gegenteil. Es kamen immer mehr Restriktionen gegenüber der italienischen Montessori-Verbandsorganisation, der Montessori-Lehrerausbildungsstätte und für den allgemeinen Schulbetrieb, beispielsweise dass die Lehrkräfte einen Eid auf den faschistischen Staat leisten sollten oder – was zum endgültigen Bruch führte – die Pflicht zum Tragen von einheitlichen staatlichen Schuluniformen. Je totalitärer Mussolini auftrat, desto mehr betonte Montessori den Friedensaspekt in ihrer Pädagogik, so bei einem internationalen Friedenskongress des Völkerbunds 1932 in Genf.[A]Montessori hielt den Vortrag "Frieden und Erziehung" auf Einladung des Bureau de l’Education, später das UNESCO International Bureau of Education, bei deren Tagung im März 1932. Nicht von dieser Tagung, aber im Bericht von der 20. Jahreskonferenz der Erziehungsverbände im Jahre 1932 wird Montessori ähnlich zitiert: "So lange die Reform der Gesellschaft nicht erfolgt ist, wird das Kind nicht geheilt sein. Es wird weiterhin das erste Opfer sein, gerade weil es schwach ist, ohne die Macht, sich zu schützen, ohne die Macht, sich zu organisieren, und ohne die wirtschaftlichen Mittel, sich zu selbst zu retten. Wenn dagegen auf der anderen Seite die Aufmerksamkeit auf das Kind gerichtet ist, wie es heute in totalitären Staaten der Fall ist, seien sie faschistisch oder kommunistisch, dann liegt die Absicht darin es auszubeuten, d.h. es für künftige nationalistische Ambitionen zu instrumentalisieren. Die Bedürfnisse der Entwicklung des Kindes und seine Rechte werden dabei nicht berücksichtigt. Noch nie hat es ein so schreckliches kollektives Verbrechen gegeben wie das, einem Kind eine Waffe in die zarten Hände zu geben und ihm beizubringen, als ultimatives Ziel im Leben seinesgleichen zu töten."
Man sagt zwar, sie hätte Mitte der 30er Jahre aus Italien „fliehen“ müssen. Das ist nicht ganz richtig. Sie lebte wegen besserer Arbeitsbedingungen ab 1917 hauptsächlich in Barcelona, wo ihr Sohn Mario später seine Familie gegründete. Sie kam immer wieder zu Besuchen nach Italien, hat sich aber dann 1934 von ihrem Heimatland abgewandt, wo die Montessori-Schulen dann in 1936 geschlossen wurden.
In Spanien hatte sie übrigens gleich zu Beginn ihres Aufenthalts erlebt, wie die katalanische Provinzregierung ein politisches Bekenntnis von ihr verlangte, was sie strikt abgelehnt hatte, da es ihr „nur um die Kinder ging“. Und nach Francos Putsch 1936 musste sie von dort tatsächlich „fliehen“, nach England.
Als Kontext darüber hinaus wichtig: Montessori hatte schon um 1913 sowohl ihre Position als Lehrbeauftragte an der Universität Rom als auch ihre Approbation als Ärztin aufgegeben, um sich ganz der Verbreitung ihrer Pädagogik zu widmen, was ihren Blick in teilweise starker Weise einengte. Aus heutiger Sicht ist diese apolitische Einstellung befremdlich.
Was ist mit dem Vorwurf, dass die Montessori-Pädagogik sich gut mit den Vorstellungen der italienischen Faschisten vom „neuen Menschen“ vertrug?
Boysen: Die faschistischen Ideologen um Mussolini herum sahen die Montessori-Pädagogik, die damals von der frühen Grundbildung (Lesen, Schreiben, Rechnen) geprägt war, also noch nicht so sehr inhaltlich ausgerichtet wie später, als geeignete Grundlage dafür, arbeitsame, disziplinierte Menschen in der Schule heranzuziehen, die „neuen Menschen“, die in der Volksgemeinschaft aufgehen. Wenn man so will, ging es um Soldatennachwuchs.
Auch Montessori sprach ja vom „neuen Menschen“. Allerdings meinte sie damit etwas ganz anderes, nämlich einen Menschen, der seine geistigen Fähigkeiten und seine Persönlichkeit voll entfaltet – und keinen Untertanen.
Sie hatte gesehen, wie viele negative Einflüsse von außen kommen können, die ein Kind daran hindern, sein Potenzial zu entwickeln. Das fing damit an, in welcher Situation die Mutter während der Schwangerschaft ist – in einer Zeit, die von Armut, Krankheiten und schlechter Ernährung geprägt war. Dazu kamen problematische Sozialstrukturen in vielen Familien und obendrauf ein autoritäres Erziehungssystem, also alles Elemente, die verhindern, dass Kinder ihr Potenzial ausschöpften. Der „neue Mensch“ ist dann einer, der sich frei von diesen schädlichen Einflüssen entwickeln kann – in Montessoris Sprachgebrauch „normalisiert“ ist.[B]Die "Normalisierung" ist nach Montessori beim Kind das Wiedererlangen des Zustands der "psychischen Gesundheit" (s. Über die Bildung des Menschen, Maria Montessori. 1947, auf deutsch erschienen im Verlag Herder 1966). Sie ist nicht zu verwechseln mit "Normierung", also einer irgendwie gearteten Vereinheitlichung im Rahmen der Erziehung. Die Normalisierung wird nach Montessori in Gang gesetzt durch zielführende Arbeit – z.B. mit dem Montessori-Material – und durch die freie Wahl der Arbeit. Eine "normale" Entwicklung eines Kindes ist demnach eine seinen natürlichen Entwicklungspotenzialitäten gemäße Entwicklung. Und das wäre für die Gesellschaft und dann schließlich für die ganze Welt ein Segen, weil dann endlich Frieden herrschen würde. Das war ihre Vision.
Gleichwohl gibt es auch Zitate von Maria Montessori, denen zufolge „die triumphierende Rasse“ aus weißen Menschen besteht, deren „Staturtyp eine Harmonie der Formen bei allen Teilen des Körpers aufweist“ – klingt nach Rassismus pur, oder?
Boysen: Es gibt tatsächlich solche Zitate. Da muss man allerdings weit zurückgehen, zwei Jahrzehnte zurück, in die Anfänge ihrer beruflichen Tätigkeit, als sie Ärztin an einer Klinik war und dann an das Pädagogische Institut der Universität in Rom kam. Von 1905 bis 1908 hat sie für Naturwissenschaftler Vorlesungen zum Thema Anthropologie gehalten, in denen sie den Studenten den damaligen Stand dieser Wissenschaft näherbrachte, der tatsächlich rassistisch geprägt war. Diese Vorlesungen hat sie auf Bitte ihrer Studenten 1910 als Buch veröffentlicht, in dem sie versuchte - so heißt auch das Buch - , eine "pädagogische Anthropologie" zu entwickeln.[C]Während Montessori von 1904 bis 1908 Vorlesungen hielt [Korrektur der Jahresangabe im Interview], sind es die Vorlesungsskripte aus 1906-1907 [wie in der Einführung des Bandes durch den Herausgeber Prof. Harald Ludwig beschrieben], als Buch mit dem Titel Pädagogische Anthropologie 1910 erschienen, auf Deutsch in 2019 als Teil der Maria Montessori gesammelte Werke, Band 2/2 - auf Englisch bereits 1913. (Für eine ausführliche Kommentierung - siehe Fußnote [C]. Montessori hatte 1902, während sie Anthropologie-Vorlesungen besuchte, beantragt, Privatdozentin für Anthropologie zu werden, was erst 1904 genehmigt wurde. Sie war also keine Professorin im klassischen Sinne. Das Buch wird verschiedentlich als ihr "wissenschaftlichstes Werk" bezeichnet, was in der Hinsicht stimmt, dass sie zwei anthropometrische Studien, die sie zwischen 1901 und 1906 an Frauen beziehungsweise Kindern durchführte, im Buch vorstellt. Das Buch zeigt zwar ihre anthropologischen Erkenntnisse aus dieser Zeit auf, ist jedoch nicht als Grundlage ihrer Pädagogik anzusehen - hier ist vor allem das 1909 geschriebene und herausgegebene Buch, Die Entdeckung des Kindes, wie im Interview erwähnt, zu nennen. Diese sollte nicht rückwärtsgewandt Menschentypen statistisch erfassen und bewerten, sondern vorwärtsgewandt negative Entwicklungen bei Kindern erkennen beziehungsweise verhindern. Vorsorgeuntersuchungen, wie wir sie heute kennen, sind ja erst viel später eingeführt worden, in Deutschland erstmalig in den siebziger Jahren durch Prof. Theodor Hellbrügge, übrigens ein großer Montessori-Verfechter.
Im Buch stehen tatsächlich Sätze, bei denen man denkt: „Um Gottes Willen!“ Im deutschen Grundgesetz ist auch noch von „Rassen“ die Rede – wir wissen heute, dass es Menschenrassen nicht gibt. Damals war die Vorstellung verbreitet. Da war sie ein Kind ihrer Zeit.[D]Das letzte Kapitel ist zwar durchzogen von damals modernen aber aus heutiger Sicht inakzeptablen Überlegungen zum „mittleren Menschen“ und zur Anwendung der Statistik auf die Anthropologie, aber auf der letzten Seite drückt sie folgende Vision aus, die man später in ihren pädagogischen Schriften wiederfindet - Siehe Fußnote unten.
Montessori hat immerhin im Buch als Fazit geschrieben, ein zivilisatorischer Fortschritt entstände erst, wenn wir alle durchmischt sind. Sie nannte das damals „Hybridisierung“, was sicher heute seltsam klingt. Das war aber das Gegenteil von den völkischen Vorstellungen beispielsweise der Nationalsozialisten in Deutschland. Sie wollte die Menschen zusammenbringen im Sinne einer „nazione unica“, wie sie es später formulierte – nicht trennen, und erst recht nicht in Kriege treiben.
Interessanterweise ist Montessoris Hauptwerk für den Elementarbereich, „Die Entdeckung des Kindes“, bereits 1909 erschienen, als Ergebnis ihrer umfangreichen Studien zur Kindesentwicklung, insbesondere seit 1907 im Rahmen ihrer „case dei bambini“. Man könnte meinen, mit der „Pädagogischen Anthropologie“ wollte sie ihre bisherige konventionelle wissenschaftliche Karriere abschließen und, losgelöst davon, ihre bahnbrechenden neuen Erkenntnisse zur Kindesentwicklung in „Die Entdeckung des Kindes“ veröffentlichen. [E]Montessori schreibt in Das Kind offenbart sich selbst (1936) zurückblickend: "Mit den ausschließlich medizinischen Behandlungen hörte ich auf und gründete am Irrenhaus von Rom eine Schule für die idiotischen Kinder, die dort untergebracht waren. Ich erinnere mich noch gut an diese revolutionäre Tat, die meinen allmählichen Übergang von der Medizin zur Pädagogik bedeuten sollte." (S. 116) Der Herausgeber Prof. Ludwig erläutert den damaligen Sprachgebrauch: "Idioten" = Kinder mit Behinderungen / "Irrenhaus" = Nervenheilanstalt. Der Übergang zur Pädagogik war geprägt durch die Erkenntnis, dass man sich nicht nur auf die "Kranken" konzentrieren brauchte, sondern durch den Fokus auf die "Gesunden" vielleicht noch wesentlichere Erkenntnisse erlangen könnte: "Warum waren nun ausgerechnet meine gesamte Ausbildung und mein unbestreitbare Erfolg das Hindernis, Zugang zur Seele der Kinder zu finden? Weil ich, wie schon gesagt, an der Krankheit interessiert war. Die Krankheit war das allein Wissenschaftliche, das allein Interessante, das allein Lohnende. Nur die Krankheit verdiente untersucht zu werden. Die Gesundheit? Die Gesundheit war gar nichts. Es war, als ob es sie nicht gäbe. Man sah dort in diesem verborgenen Bereich, kein Forschungsproblem." (S. 118)
In der wissenschaftlichen Gesamtausgabe dieses Werkes lässt sich aus den dort dokumentierten Änderungen in vier weiteren Ausgaben, zuletzt von 1950, übrigens gut erkennen, wie sie ihre Pädagogik weiterentwickelt hat. Es ist daher wichtig zu verstehen, in welchem Kontext manches entstanden ist. Sprachlich spiegelt sich in ihren Werken der Wandel wider, den die gesamte Menschheit gegangen ist. Man darf nicht vergessen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts wissenschaftliche Ansätze zur Lerntheorie, wonach Intelligenz nicht nur vererbt ist, sich gerade entwickelten.
Kommen wir doch nochmal zur Pädagogik. Behauptet wird, dass die Betonung von Gehorsam und Hingabe in der Montessori-Pädagogik zu soldatischen Prinzipien wie Unterordnung, Disziplin und Ordnung – und damit letztlich zum faschistischen Menschenbild – führe. Wie stehen Sie dazu?
Boysen: Es ist eher umgekehrt. Montessori hat bei Kindern beobachtet, dass sie konzentriert lernen, wenn die Bedingungen stimmen. Und deshalb war sie darauf fokussiert, eine Umgebung zu schaffen, in der die Kinder in diese – wie sie es genannt hat – Polarisation der Aufmerksamkeit kommen. Heute würde man vielleicht von Flow sprechen: ein Zustand, in dem sich Kinder in Ruhe und mit Lernfreude mit Material beschäftigen können, das ihnen Erkenntnisse erlaubt, ihre Kompetenzen festigt und ihre Entwicklung fördert. Das hat mit Gehorchen, Drill und Zwang rein gar nichts zu tun.
Je länger sie gewirkt hat, desto wichtiger wurde es für sie, zuallererst die Individualität aller Kinder als Grundlage jedes pädagogischen Ansatzes zu betonen. Damit hat sie sich losgelöst von den verbreiteten Vorstellungen ihrer Zeit. Am Ende ging es darum, jedem Kind zu helfen, sein Potenzial zu entwickeln. Hierbei war ihr wichtig, dass das Kind eine innere Disziplin entwickelt und „Meister seiner selbst“ wird.
Wenn Montessori ihre Pädagogik in ihren Schriften entwickelt hat, heißt das vermutlich auch, dass es bessere und schlechtere Texte von ihr gibt. Ein Personenkult lässt sich damit nicht begründen, oder?
Boysen: Natürlich nicht. Maria Montessori war keine Heilige, und die Montessori-Pädagogik ist keine religiöse Bewegung. Sie war zweifellos eine geniale Pädagogin und herausragende, teilweise widersprüchliche Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts. Vieles, was sie empirisch erkannt hat, ist später durch die Wissenschaft bestätigt worden. Sie ist die Begründerin der Montessori-Pädagogik, die ihren Namen zurecht trägt, aber das kann ja nicht bedeuten, dass wir alle in ihrer Zeit festsitzen. Zu ihren Lebzeiten stand sie sich meiner Meinung nach teilweise selbst im Weg, da sie nach der Entwicklung ihrer Pädagogik deren didaktische Umsetzungsmechanismen als etwas eher Abgeschlossenes betrachtete.
Eine Pädagogik steht jedoch vor immer neuen Herausforderungen und muss sich daher entwickeln. Maria Montessori selbst spricht von „Kindern ihrer Zeit, ihres Ortes und ihres Raumes“, regt damit zu notwendigen pädagogischen/didaktischen Schlussfolgerungen und somit zur Entwicklung und Veränderung der Pädagogik an. Wichtig bleiben die Grundprämissen: das Kind in seiner Individualität zu sehen und mit einer vorbereiteten Lernumgebung seine Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit zu fördern.
Das ist das Gegenteil von autoritärer Erziehung, wie sie in faschistischen Gesellschaftsordnungen propagiert wurde. Auch wer die grundsätzliche Haltung vertritt: „Kinder sind faul und brauchen Druck" – der landet pädagogisch auf einem anderen Stern.
Manche von Montessoris Erkenntnissen erscheinen aus heutiger Sicht als Selbstverständlichkeiten, was zeigt, wie diese Erkenntnisse in unser Bildungs- und Erziehungsverständnis eingeflossen sind. Wenn ich aber unser heutiges Regelschulsystem anschaue, dann erkenne ich nicht, dass ein Fokus „vom Kinde aus“ konsequent umgesetzt worden wäre.
Sind somit alle Vorwürfe entkräftet?
Boysen: Ich habe mich in meinen Antworten darauf konzentriert, den Vorwürfen bezüglich Faschismus zu entgegnen. Damit ist selbstverständlich nicht jede Kritik an Maria Montessori erledigt.
Seit Jahrzehnten setzen sich Fachleute, darunter viele Montessori-Pädagog:innen, in Fachbeiträgen und -büchern mit der Entwicklung ihrer Pädagogik und mit ihrer Person auseinander.
Selbstverständlich sehen auch wir uns bei Montessori Deutschland aufgefordert, die Montessori-Pädagogik fortlaufend zu bewerten. Dazu trägt eine kontinuierliche Diskussion bei, an der wir uns aktiv beteiligen. Wir wollen, dass die Pädagogik lebendig, relevant und effektiv bleibt.